Detaillierter Ablaufplan siehe unten
Der 33. Internationale Filmhistorische Kongress ist integraler Teil des cinefest und vertieft die Themen des Festivals in Vorträgen und Diskussionen. Er wird am Abend des 19.11.2020 im Metropolis-Kino eröffnet. Während der Veranstaltung werden auch die Willy Haas-Preise für eine bedeutende internationale Publikation (Buch und DVD) verliehen. Die Vorträge des Kongresses finden vom 20.-22.11.2020, jeweils von 9:30 – 16:00 Uhr, im Kommunalen Kino Metropolis statt. Für die Teilnahme ist die vorherige Akkreditierung erforderlich
Die Vorträge sind auf ca. 20 Minuten angesetzt und werden anschließend im Plenum diskutiert. Die Konferenzsprachen sind Deutsch oder Englisch (es gibt keine Live-Übersetzung).
Aufgrund der Einschränkungen durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bieten wir dieses Jahr für den Kongress auch eine Teilnahme über Live-Streaming an.
Stundenplan
Samstag, 21.11.2020
- PANEL 3: NATIONALSOZIALISMUS
- 09:30 - 10:15
- Drehte für Deutschland - Frits van Dongen, ein Niederländer in Harlans Filmen VERWEHTE SPUREN und DIE REISE NACH TILSIT
-
Sprecher:in
- 10:15 - 10:35
- Pause
- 10:35 - 11.20
- Appropriating a Dutch Myth, Germanizing History. Film music and Genius’ Cult in REMBRANDT (1941/1942)
- True to his role as one of the leading ideological film directors of the Third Reich, Hans Steinhoff’s ‘apolitical’ cinematic works are considered to be imbued with an underlying National-Socialist imprint (Köppen 2007: 70), as it can be exemplified in one of his last feature films: REMBRANDT (1941/1942). The biopic, with its many parallels with the homonymous Alexander Korda’s 1936 film and partially produced in the occupied Netherlands, belongs to some of most expensive features of the Reich’s film industry (Claus 2013: 474), allowing Steinhoff to employ a number of the most sought-after personalities for the film. Such is the case with Alois Melichar, at the time one of the most prominent score composers, whose stylistic and compositional attributes made him an impeccable choice for a person responsible for REMBRANDT’s film music. Melichar’s prolific output as a film composer was widely neglected, but his work left a lasting mark in the Austro-German cinema and was investigated only recently (Schmidl 2018). Composer’s versatile paraphrasing and adaptation of existing musical pieces – for instance, 1939 UNSTERBLICHER WALZER and 1942 WEN DIE GÖTTER LIEBEN, dealing with Johann Strauss I and W. A. Mozart respectively – constitute one aspect of Melichar’s appropriation technique against the background of his scoring for biopics. Whereas Steinhoff’s REMBRANDT was thoroughly examined in production and film studies (Claus 2013, Köppen 2007, Schiweck 2001), a crucial meta-layer of the film, namely its music, has been mostly disregarded. The main aim of the paper would be the investigation of REMBRANDT against the backdrop of clearly political (Steinhoff’s) approach in appropriating one of Holland’s most important painters. This ideological ‘coloring’ and pilfering of Rembrandt’s reception and, – through the artist, Dutch – representation is to be examined through the prism of the film’s music and the wider context of National-Socialist Genius’ Cult.
-
Sprecher:in
- 11:20 - 11:40
- Pause
- PANEL 4: NIEDERLANDE ALS EXIL
- 11:40 - 12:25
- Der niederländische Spielfilm der dreißiger Jahre und die deutsche Filmemigration
- Seit Adolf Hitlers Machtübernahme 1933 und der Besetzung der Niederlande durch die deutsche Wehrmacht im Mai 1940 sind in den Niederlanden 37 abendfüllende Spielfilme produziert worden. An fast allen dieser Filme, Komödien mit überwiegend niederländischen Themen, Schauplätzen, Milieus, Liedern, haben Emigranten aus Nazi-Deutschland mitgearbeitet. Nicht sichtbar als Schauspieler auf der Leinwand. Wer konnte schon in der beginnenden Ära des Tonfilms Niederländisch? Aber hinter den Kulissen als Produzenten, Regisseure wie etwa Max Ophüls, Kurt Gerron, Detlef Sierck oder Ludwig Berger, als Kameraleute, Cutter, Tontechniker und…und. Die niederländische Regierung und die noch schwache niederländische Filmwirtschaft hegten gemischte Gefühle gegenüber diesen „Ausländern“ („buitenlanders“). Die Politik wollte den großen bedrohlichen deutschen Nachbarn nicht mit kritischen Inhalten verärgern, mit dem sie wirtschaftlich eng verbunden war und weiterhin blieb (auch bei filmischen Co-produktionen), die Filmwirtschaft sah in diesen „Ausländern“ auch eine Verdrängung einheimischer Film-Kräfte beim so ersehnten Aufbau einer eigenen national-niederländischen Filmproduktion und das Publikum wollte Unterhaltung und bekam diese auch wie überall in den Exilländern bis 1939.
-
Sprecher:in
- 12:25 - 12:35
- Pause
- 13:00 - 14:00
- Mittagspause
- PANEL 5: NACHKRIEG + VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG
- 14:00 - 14:45
- Selbstbild und Fremdbild im niederländischen Kriegsfilm 1948 bis 1962
- Zentrale Entwicklungstendenzen der deutsch-niederländischen Beziehungen spiegeln sich in den audiovisuellen Repräsentationen des 'Deutschen' im niederländischen Nachkriegsfilm. Ausgangspunkt dieser Beziehungen sind die Kriegs- und Besatzungserfahrungen 1940 bis 1945. Nicht zufällig zählen die Widerstandsfilme Niet tevergeefs (1948) und L.O.-L.K.P. (1949) zu den ersten professionellen Spielfilmproduktionen in den Niederlanden. Zusammen mit De Overval (1962) können sie heute als wertvolle Quellen zur Analyse von Selbst- und Fremdbildern dienen, da sie tabuisierte und traumatische Aspekte der deutschen Besatzungszeit thematisierten und zur Neuverhandlung ausgewählter Geschichts- und Beziehungsbilder beitrugen. Führte die schnelle militärische Niederlange im Mai 1940 und die Flucht des niederländischen Königshauses nach England zum Verlust nationaler, identitätsbildender Narrative, erschütterte die "relatief langdurige bereidheid tot bureaucratische samenwerking met de bezetter"1 nachhaltig die moralische Grundlage der niederländischen Identität. Der Beitrag thematisiert, wie die Filmproduzenten sich den Deutungsspielraum des Mediums zunutze machten, um die Besatzungserfahrung durch die Homogenisierung und Stereotypisierung der Widerstandsgeschichte dennoch in ein narratives Netz kollektiver Sinnstiftung zu integrieren. Die überwiegend im christlichen Glaubensverständnis verwurzelte Ethik des widerständischen Handelns bot den zeitgenössischen Zuschauern ein Gegenbild zum nationalsozialistischen Tätertypus. Auf verschiedenen Ebenen dient dieses Gegenbild als geeignete Projektionsfläche, um die traumatische Kriegserfahrung der meisten Niederländer*innen aufzufangen und eine Brücke zur Wiederherstellung bedrohter Identitätskonzepte zu schlagen.
-
Sprecher:in
- 14:45 - 15:15
- Pause
- 15:15 - 16:00
- "Der Film beginnt ohne Musik – auf der Leinwand erscheint das Portraitfoto eines weiblichen Häftlings" – Joop Huisken, Renate Drescher und der Film über das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück
- „Der Film beginnt ohne Musik – auf der Leinwand erscheint das Portraitfoto eines weiblichen Häftlings – ein gedankenvolles Gesicht, mit kahlgeschorenem Kopf. Es folgen 3 solcher Fotos, – 10 Fotos, 30 Fotos von jungen und alten Frauen in KZ-Kleidung. Die Fotos blenden aus, es erscheint der Titel: Frauen in Ravens-brück.“ [MGR/SBG, 1967, Bl.17, Joop Huisken, Renate Drescher] Auf Basis eines Kapitels meiner Dissertation zu Ravensbrück im Film über den Einführungsfilm Frauen in Ravensbrück (DDR 1968) von Joop Huisken und Renate Drescher für die NMG Ravensbrück, möchte ich die komplexe Arbeitsweise der Dokumentarfilmer Joop Huisken und seiner damals jungen Regie-Assis-tentin Renate Drescher, mit der ich 2014 mehrere Interviews führen konnte, nachzeichnen. Besonderer Fokus soll auf Joop Huiskens eigener Erfahrung in der Arbeitsdienstverpflichtung bei der Universum Film AG (Ufa) in Potsdam-Babelsberg liegen und der Frage, wie sich diese Zeit als Spur im Film abbildet.
-
Sprecher:in
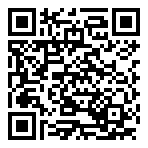
Datum
- 21. Nov. 2020
- Abgelaufene Events
Uhrzeit
Ort



